Überblick zum Präventionsthema
Das Thema des Präventionsjahres von Jugend will sich-er-leben 2025/26 ist Gewaltprävention in Ausbildung und Beruf.
Das Motto lautet: Gewaltfrei? Bin dabei! Sicher in Ausbildung und Beruf.
Wieso dieses Thema?
Jede fünfte Person weltweit ist von Gewalt am Arbeitsplatz betroffen (Quelle: ILO).
Gewalt kann bei Betroffenen großen Schaden verursachen – nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Sie hat zudem Auswirkungen auf das soziale und betriebliche Umfeld. Deshalb sensibilisiert JWSL Auszubildende unter dem Motto „Gewaltfrei? Bin dabei! Sicher in Ausbildung und Beruf“ für das Thema „Gewaltprävention in Ausbildung und Beruf“. Gewalt kann überall vorkommen, in allen Lebensbereichen, in allen Gesellschaftsschichten und an allen Orten. Sie kann jede und jeden betreffen und geht alle etwas an. Das bedeutet wiederum: Alle können etwas gegen Gewalt tun.
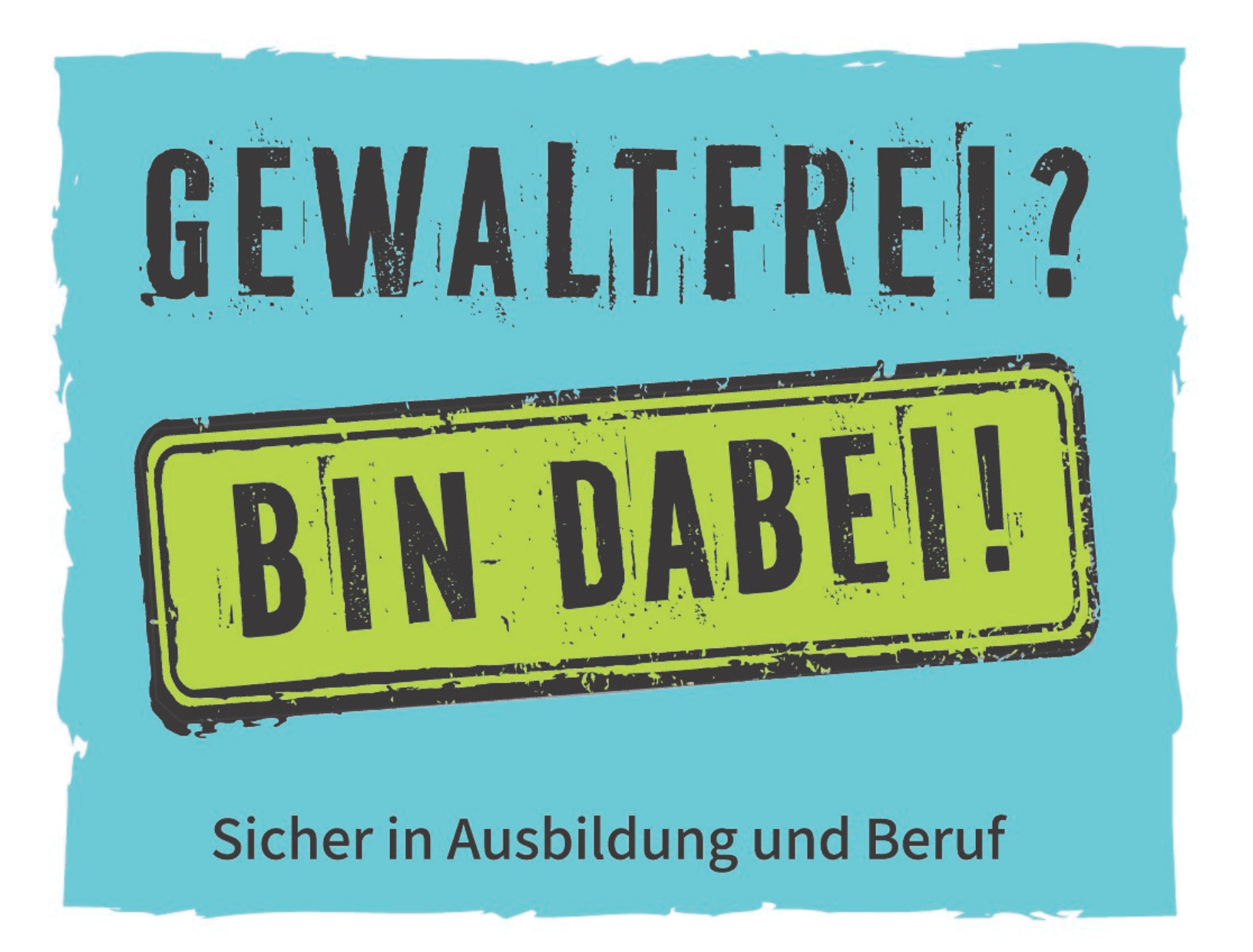
Die Materialien aus dem JWSL-Medienpaket setzen Anreize zur Sensibilisierung im Unterricht und im Betrieb sowie zur individuellen Auseinandersetzung mit dem Thema: Denn wo fängt Gewalt eigentlich an? Welche Ursachen und Auswirkungen kann Gewalt haben? Welche Rahmenbedinungen und Schutzmaßnahmen gibt es in Betrieb und Schule und wie können Azubis darüber hinaus selbst aktiv gegen Gewalt eintreten? Welche Strategien helfen, Risiken am Arbeitsplatz zu erkennen und Gewalt vorzubeugen? Wie handelt man im Ernstfall und wo gibt es Unterstützung?
Was ist Gewalt bei der Arbeit?
Jeder Mensch hat laut Gesetz das Recht auf eine Arbeitswelt ohne Gewalt und Belästigung.
Gewalt kann ein Angriff sowohl auf den Körper als auch auf die Psyche, zum Beispiel das Gefühlsleben, sein: etwa durch Schläge oder Mobbing. Sie kann verbal (durch die Wortwahl) oder nonverbal (durch Gestik, Mimik, Körperhaltung) stattfinden oder geschlechtsspezifisch sein. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) beschreibt Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt als „eine Bandbreite von inakzeptablen Verhaltensweisen und Praktiken oder deren Androhung […], die auf physischen, psychischen, sexuellen oder wirtschaftlichen Schaden abzielen, diesen zur Folge haben oder wahrscheinlich zur Folge haben, und umfasst auch geschlechtsspezifische Gewalt und Belästigung“.
Zur weiteren Einordnung lässt sich im Arbeitskontext unterscheiden zwischen externer Gewalt, verursacht zum Beispiel durch Kundinnen und Kunden oder Besucherinnen und Besucher, sowie interner Gewalt, die von Führungskräften, Kolleginnen oder Kollegen ausgeht.
Wichtig ist, ein gemeinsames Wertesystem zu haben, das die Regeln für das Zusammenleben festlegt. Ob in der Schule, im Betrieb, im kleinen Verein oder im World Wide Web: Allen muss klar sein, welches Verhalten nicht akzeptiert wird, was die „rote Linie“ ist und wie mit Grenzüberschreitungen umgegangen wird.
Die Gründe für Gewalt am Arbeitsplatz sind komplex, für jede Situation spezifisch und resultieren oft aus einem Wechselspiel verschiedener Ursachen. Neben Auslösebedingungen der Umgebung wie baulich-technischen Gegebenheiten können Probleme in der Organisation Auslöser für Gewalt sein. Aber auch personenbezogene Ursachen können als Faktor infrage kommen.
Ursachen für Gewalt

Gewalt kennt keine Grenzen
Gewaltvorfälle sind nicht nur auf bestimmte Bereiche beschränkt. Sie können sich jederzeit und überall ereignen – sowohl im beruflichen Umfeld als auch im privaten: also in der Schule und am Arbeitsplatz, unterwegs oder zu Hause – im „echten“ Leben als auch im Internet. Gewalt bei der Arbeit kann alle treffen. Allerdings gibt es Arbeitsplätze, die ein besonders hohes Risiko aufweisen: zum Beispiel Umgang mit Wertgegenständen oder Bargeld, Alleinarbeit, Ausübung von Kontrollaufgaben, Umgang mit schwierigen Personengruppen. Weitere Zahlen und Fakten rund um Gewalt finden sich hier.
Mehr als bloße Worte

Unklare Kommunikation kann eine mögliche Konfliktursache sein. Das Kommunikationsquadrat nach Friedemann Schulz von Thun, auch bekannt als Vier Seiten-Modell, zeigt, wie vielschichtig Kommunikation ist, und hilft dabei, Missverständnisse zu erkennen und gezielt zu entschärfen, damit es nicht zu Konflikten und Gewalt kommt. Das Kommunikationsquadrat beschreibt, dass jede Äußerung auf vier verschiedenen Ebenen gleichzeitig Botschaften vermittelt.Diese Ebenen sind: Sachinhalt, Selbstkundgabe, Beziehungshinweis, Appell. Jede Nachricht wird von einem Sender auf allen vier Ebenen gleichzeitig gesendet, und der Empfänger kann sie ebenfalls auf allen vier Ebenen wahrnehmen. Konflikte entstehen dann, wenn der Sender und der Empfänger unterschiedliche Ebenen in den Vordergrund stellen oder diese missverstehen.
Mit Köpfchen statt Kurzschluss
Strategien zur Stärkung der Selbst- und Impulskontrolle können vielseitig und in unterschiedlichen Alltagssituationen hilfreich sein – und konfliktreiche Situationen entschärfen. Sie unterstützen soziale Interaktionen und sorgen durch bewusstes Handeln für ein wertschätzendes Miteinander. Sie wirken aber ebenso beispielsweise beim Lernen oder beim Konsumverhalten (zum Beispiel Essen, Einkauf, Soziale Medien). Routinen und klare Strukturen unterstützen die positive Entwicklung zusätzlich und können dazu beitragen, sich selbst besser verstehen und beherrschen zu können.Routinen und klare Strukturen unterstützen die positive Entwicklung zusätzlich und können dazu beitragen, sich selbst besser verstehen und beherrschen zu können.

Notfallübungen
Wenn ihr bei euch oder anderen das Gefühl habt, dass ihr kurz davor seid, zu eskalieren, helfen folgende Übungen, impulsive Reaktionen zu verzögern und überlegtere Entscheidungen zu treffen.
Wenn ihr das Gefühl habt, impulsiv reagieren zu wollen, zählt innerlich bis fünf, bevor ihr handelt. Überlegt dann, welche mögliche Konsequenzen dieser Impuls haben könnte, zum Beispiel: „Wie würde sich mein Gegenüber fühlen?“ oder „Wie könnte meine Reaktion das langfristige Arbeitsverhältnis verändern?“ Danach könnt ihr die Entscheidung über eure Reaktion bewusster treffen.
Eine kritische Interaktion kann entschärft werden, indem sie unterbrochen wird. Dadurch wird die Impulshandlung verzögert und gegebenenfalls verhindert. Wenn ihr selbst in der Situation seid, funktioniert das etwa, indem ihr aufsteht und ein Fenster öffnet oder ein Glas Wasser holt. Es kann auch helfen, eine weitere Person hinzuzurufen oder die involvierten Personen auf ein anderes Thema anzusprechen.
Warum gewaltfreies Streiten wichtig ist
Konflikte, die nicht frühzeitig angesprochen werden, eskalieren später oft und können sich dann in Wut und Aggressionen entladen. Deswegen:
- Probleme offen ansprechen
- Gemeinsam nach Lösungen suchen
So geht Streiten richtig:
- Sei ehrlich zu dir und deinem Gegenüber
- Lass die andere Person ausreden und antworte konkret
- Formuliere deine Aussagen als Ich-Botschaften, in denen du deine Wahrnehmung ausdrückst, statt andere in einer Du-Botschaft zu beschuldigen
- Sei offen für die Sicht der anderen Person anstatt stur zu bleiben
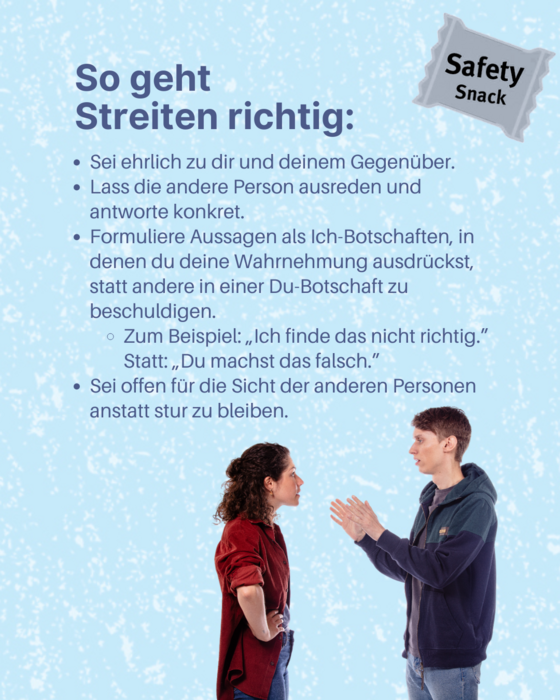
Deeskalation
Deeskalation basiert im Kern auf gezielter Intervention. Dazu zählen verbale und nonverbale Maßnahmen, die abhängig von den konkreten Umständen sind.
Grundregeln der Deeskalation finden sich hier.
Wissenswertes zu gewaltfreier Kommunikation nach Rosenberg
Der Psychologe Marshall Rosenberg entwickelte das Kommunikationsmodell der Gewaltfreien Kommunikation (GFK), das darauf abzielt, empathische und respektvolle Gespräche zu fördern und Konflikte konstruktiv zu lösen. Es basiert auf vier Schritten, die im Gespräch zum Ausdruck kommen:
- Beobachtung – Eine neutrale Beschreibung der Geschehnisse ohne Bewertung oder Interpretation, zum Beispiel: „Wenn der Fahrradschuppen nicht abgeschlossen ist, passiert es immer wieder, dass Fahrräder gestohlen werden.“
- Gefühl – Die Wahrnehmung und Benennung aller Emotionen, die durch die Situation ausgelöst werden, zum Beispiel: „Wenn der Fahrradschuppen nicht abgeschlossen ist, sorge ich mich um mein Fahrrad.“
- Bedürfnis – Die eindeutige Vermittlung, welches grundlegende Bedürfnis hinter dem Gefühl steht, zum Beispiel: „Ich möchte mein Fahrrad behalten. Ich mag es und bin darauf angewiesen, um zur Arbeit zu kommen.“
- Bitte – Eine konkrete Aussage, um das Bedürfnis zu erfüllen ohne Zwang oder Forderung, zum Beispiel: „Bitte schließe nach jedem Benutzen den Fahrradschuppen wieder ab.“
Du bist nicht allein! Zuständigkeiten im Betrieb
Keine Sorge - Vorsorge!
Jeder Betrieb muss für sichere Arbeitsplätze sorgen. Eine Grundlage für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ist die „Gefährdungsbeurteilung“ nach dem Arbeitsschutzgesetz: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber beurteilen dabei die Arbeitsbedingungen und die mit der Arbeit verbundenen Gefährdungen – auch in Bezug auf Gewaltrisiken. Auf dieser Basis werden Schutzmaßnahmen nach dem TOP-Prinzip festgelegt, um Gefährdungen zu minimieren. Das gilt auch für das Thema „Gewalt“:
Technische Schutzmaßnahmen: zum Beispiel bauliche Maßnahmen wie Beleuchtung und Gestaltung von Wartezonen, Zutrittsregelungen, Alarmierungsmöglichkeiten
Organisatorische Schutzmaßnahmen (zum Beispiel Vermeidung von Alleinarbeit, Beschwerdemanagement, Grundsatzerklärung gegen Gewalt, Erstellung eines Notfallkonzepts, psychologische Erstbetreuende ausbilden)
Personenbezogene Schutzmaßnahmen (zum Beispiel Deeskalations-trainings, persönliche Schutzausrüstung, Gefahrenbewusstsein schaffen beispielsweise durch Unterweisungen, regelmäßige Supervision)
Es ist wichtig, das Thema "Gewalt" explizit in die Gefährdungsbeurteilung aufzunehmen. Und: Wie bei allen Arbeitsunfällen ist es von Bedeutung, Gewaltvorfälle im Betrieb zu dokumentieren und zu melden - gerade weil bei Gewaltereignissen psychische Folgen zeitverzögert auftreten können. Betriebe haben hier intern unterschiedliche Verfahren. Unabhängig davon gilt: Auch eine Unfallanzeige an den zuständigen Unfallversicherungsträger kann oft sinnvoll oder sogar vorgeschrieben sein.
Wenn Gewalt droht: Das Aachener Modell
Das "Aachener Modell" strukturiert das komplexe Thema Gewalt. Es stellt eine Art Leitfaden dar, mit dessen Hilfe eine vorausschauende Sicherheits- und Nofallorganisation entwickelt werden kann. Das Modell unterscheidet Gewalt in vier Gefährdungslagen:
Jedes Gewaltszenario ist anders und erfordert eine angepasst Reaktion. Das Aachener Modell hilft zu unterscheiden zwischen Situationen, in denen deeskalation eine Situation womöglich lösen kann (Stufe 0 und 1), und solchen, in denen die Eigensicherung im Vordergrund stehen muss (ab Stufe 2). Ab Gefahrenstufe 2 gilt: Sicherheit ist von Profis herzustellen. Mehr dazu findet sich hier.
Im Arbeitskontext ist wichtig, immer zu kären, ob im Betrieb ein konkretes Notfallkonzept oder eine Betriebsvereinbarung zum Thema Gewalt bestimmte Vorgehensweisen vorgibt.
Hier beginnt Heilung: psychologische Hilfe nach Gewalterfahrung

